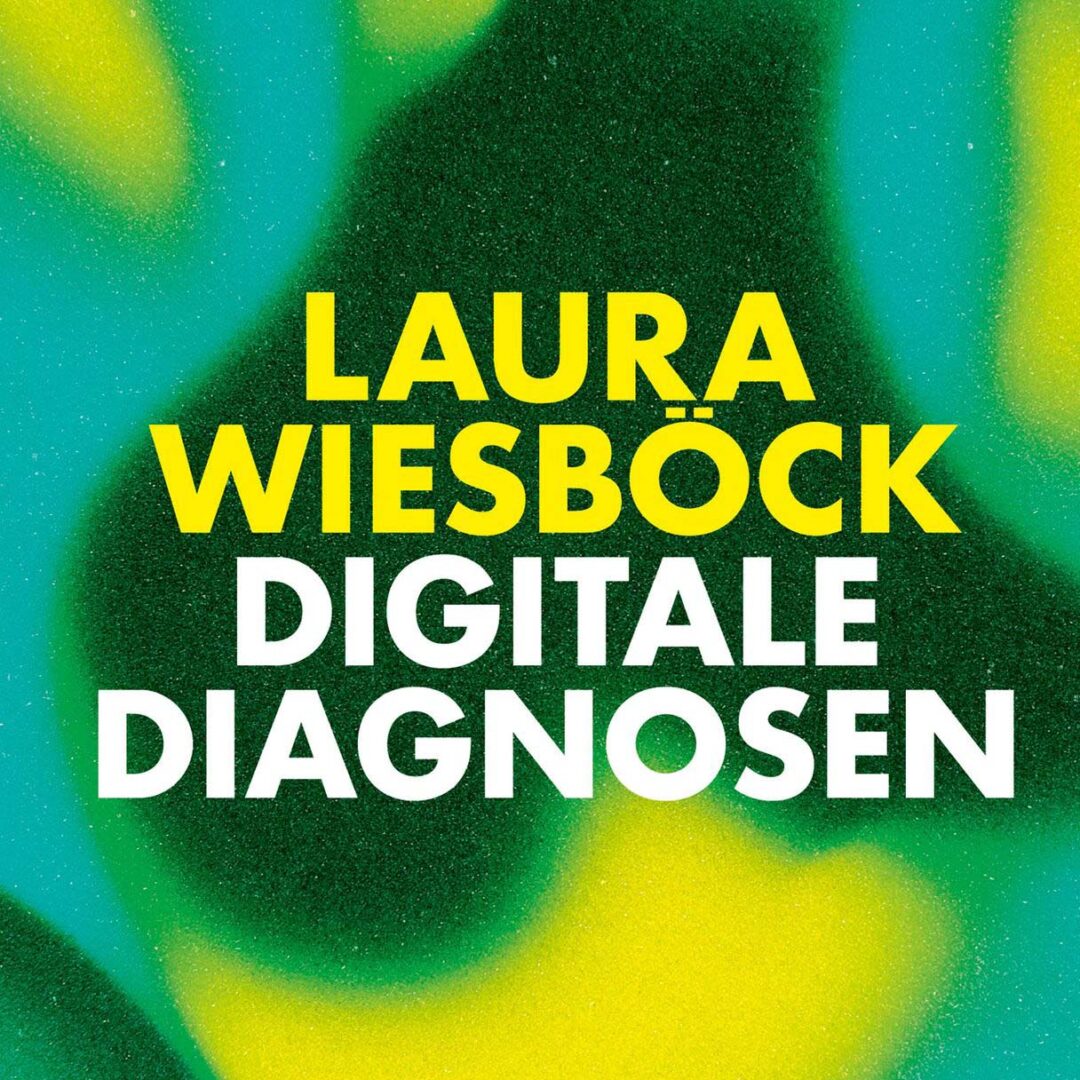Mitte Jänner erhob Elon Musk bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump den Arm zum Hitlergruß. Darauf folgte nicht nur weitreichende Empörung, manche verteidigten den Tech-Milliardär ausgerechnet damit, dass sein Verhalten möglicherweise durch das Asperger-Syndrom zu erklären sei.
Das Asperger-Syndrom ist eine Form von Autismus, die unter anderem durch Schwierigkeiten in sozialer Interaktion gekennzeichnet ist. Dass es als Begründung für Musks Hitlergruß herangezogen wurde, wurde von Betroffenen und Fachleuten umgehend kritisiert, zumal Musks Diagnose ungesichert ist und auf seiner eigenen Aussage in einer TV-Show basiert. Egal ob Autist oder Faschist, unabhängig von Musk ist jedenfalls zu bemerken: Dass ein Mann in solch einer Machtposition über seine psychische Störung redet, wäre vor nicht allzu langer Zeit äußerst unwahrscheinlich gewesen.
Folgt man Laura Wiesböck, könnte man aber auch sagen, dass man es in diesem Fall mit einer Form von »illness appropriation« zu tun hat: Menschen führen psychische Erkrankungen an, um sich der Verantwortung zu entziehen, wenn man sich unangemessen verhalten hat. Nach dem Hitlergruß musste Musk die Erkrankung nicht mal selbst erwähnen, das wurde von anderen erledigt.
Enttabuisierung
Insofern steht das Ganze sinnbildlich dafür, dass psychische Erkrankungen nicht nur immer verbreiteter sind, sondern das Reden darüber auch weniger tabuisiert ist als früher. Einen entscheidenden Beitrag dafür haben die sozialen Medien geleistet. Dieser Befund steht am Anfang von Wiesböcks neuem Buch Digitale Diagnosen – Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend. Die am Wiener Institut für Höhere Studien tätige Soziologin geht darin vor allem der Frage nach, wo die Grenze zwischen Enttabuisierung und Verherrlichung psychischer bzw. psychiatrischer Erkrankungen verläuft.
Doch bleiben wir zunächst bei den sozialen Medien. Hier bestehe »eine große Bereitschaft, sich mit psychiatrischen Diagnosen zu identifizieren und diese öffentlich zu zeigen«. Das hat durchaus positive Seiten: Es stärkt Betroffene, schafft Communitys und fördert Offenheit für das Thema. Gleichzeitig ist daraus ein Geschäft für Influencer:innen und Gesundheitskonzerne geworden – persönliche, emotionale, eigentlich intime Inhalte funktionieren nach der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie in den sozialen Medien besonders gut. Wiesböck erwähnt beispielhaft ein fünfsekündiges Video einer offenbar depressiven Tiktokerin: Unterlegt von trauriger Musik, sieht man sie weinen – das Video hat Views im zweistelligen Millionenbereich.
Influencer:innen sprechen ein Publikum an, das selbst nach Wegen sucht, sich zu inszenieren und mittels therapeutischer Begrifflichkeiten auszudrücken, was sie empfinden. Hat man ein paar Clips à la »Fünf Anzeichen, dass du ADHS hast« gesehen, wird man darin bestärkt, dass man nicht einfach ein diffuses Gefühl hat, überfordert zu sein, nein, man hat ADHS.
Die Probleme liegen auf der Hand: etwa die Gleichsetzung von persönlicher Betroffenheit und Expertise; die algorithmische Sogwirkung, bei der man immer mehr vom selben zu sehen bekommt, mit dem Ergebnis, dass man absolut überzeugt ist, auch betroffen zu sein; eine trivialisierende Darstellung von psychischen Störungen; oder die enge Verknüpfung von Mental-Health-Content mit Werbeaktionen von Gesundheitskonzernen.
Vereindeutigen und Kategorisieren
Laut Wiesböck dient die digitale (Selbst-)Diagnose nicht nur der Vereindeutigung eines Zustands, sondern auch der Selbstkategorisierung – sowohl für sich als auch für die Followerschaft. Das Vereindeutigen und Kategorisieren erklärt der Autorin zufolge auch, warum sich Begriffe wie »toxisch« oder »triggern« so ausgebreitet haben: Sie vereinfachen komplexe soziale Situationen und bieten Handlungsorientierung. Sich von toxischen Menschen oder triggernden Situationen zu distanzieren, könne ein wichtiger Akt des Selbstschutzes sein, schreibt Wiesböck. Doch sie warnt auch davor, vorschnell derlei Labels zu verteilen, nur weil etwas nicht den eigenen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Ihr Buch versteht sie daher als Plädoyer für das Aushalten emotionaler Ambivalenzen.
Wiesböck findet einen reflektierten Mittelweg zwischen immer wieder anzutreffenden übersteigerten Positionen – einerseits jener, die in Neurodiversität abschätzig nur eine woke Mode sieht, andererseits jener, wonach es gleich ein Zeichen von Empowerment und einer vielfältigen, inklusiven Gesellschaft ist, wenn sich immer mehr Menschen als Teil der neurodiversen Community fühlen, nachdem sie von unzähligen Tiktok-Clips überhäuft wurden.
Darüber hinaus geht Wiesböck in der zweiten Buchhälfte ausführlich auf Mental Health und Selfcare als Tools einer neoliberalen Konsumkultur ein, die den Menschen Selbstoptimierung einbläuen und sie wettbewerbsfit machen wollen. Das ist alles nicht falsch, richtet das Scheinwerferlicht allerdings doch etwas weg vom zunächst zentralen Thema des Umgangs mit psychiatrischen Diagnosen im digitalen Raum – und wurde letztlich schon oft ausführlich beschrieben.
Dennoch, wer verstehen möchte, warum sich psychiatrisches Vokabular zunehmend in der Alltagssprache auftaucht und sich immer mehr Menschen als neurodivers identifizieren – vor allem solche, die viel in Social Media sind –, bekommt mit Digitale Diagnosen einen gut strukturierten Band an die Hand, der sich kritisch positioniert und nüchtern und pointiert seine Argumente vorträgt.
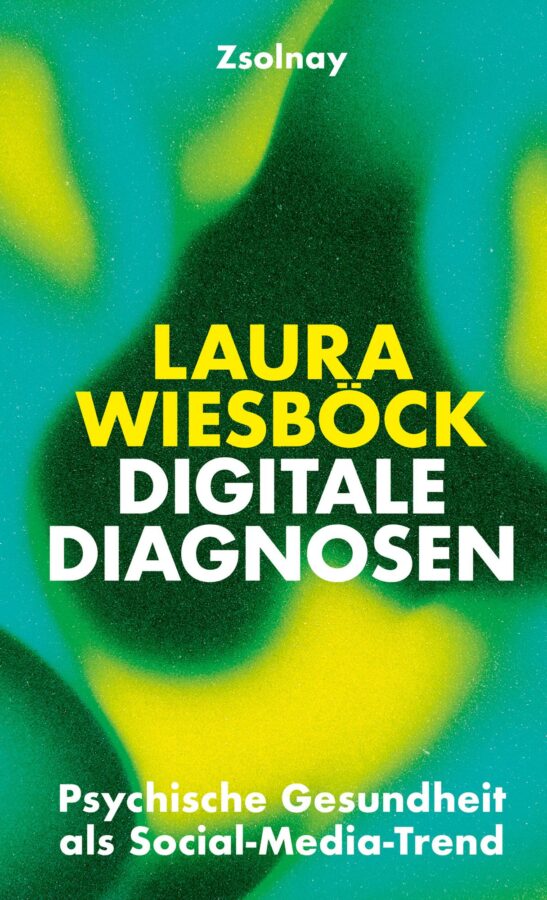
Digitale Diagnosen
Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend
Zsolnay, 2025, 176 Seiten
EUR 22,70 (AT), EUR 22,00 (DE)
Ihre Spende für kritischen Journalismus
Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.