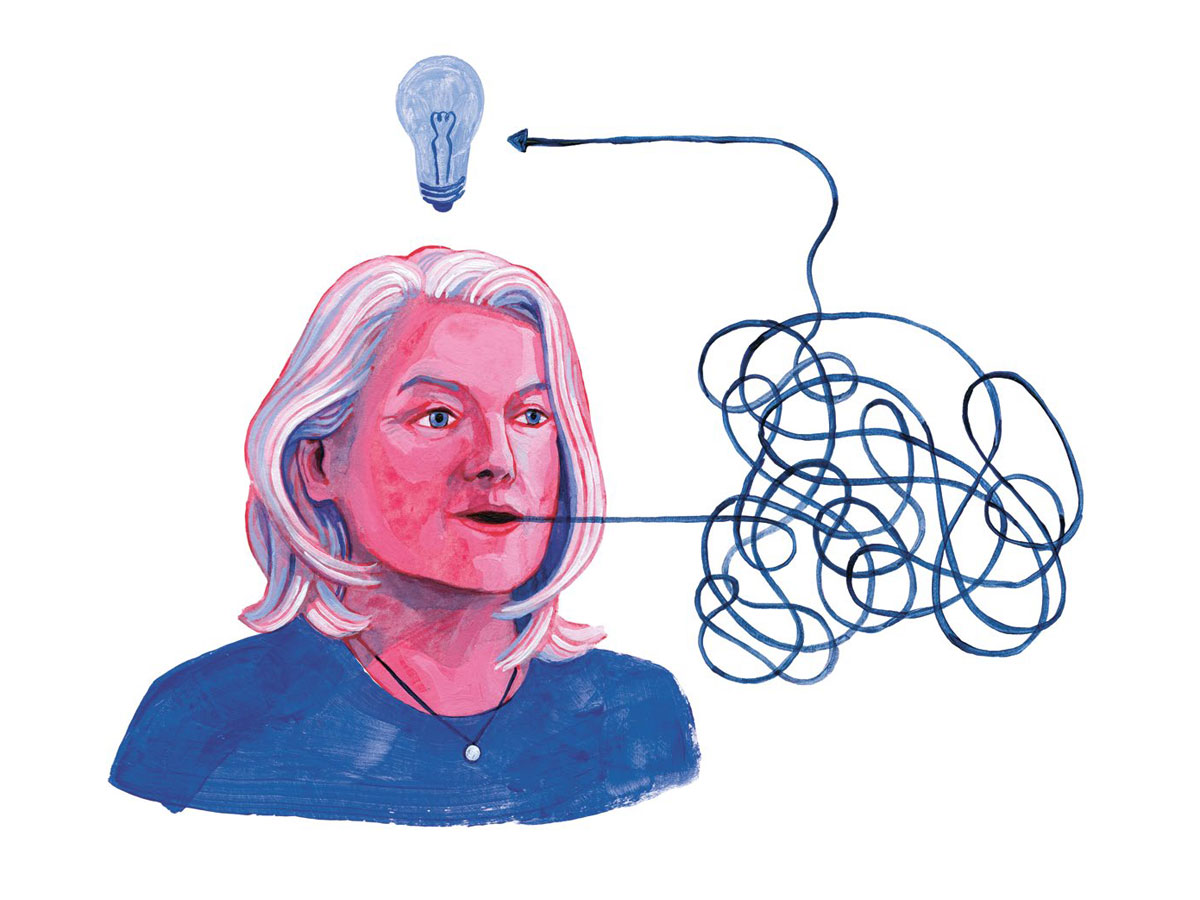Marlene Streeruwitz ist eine verdienstvolle Autorin und zugleich eine öffentliche Intellektuelle, die sich zu aktuellen politischen Debatten äußert – und auch in ihrer Literatur rasch und souverän auf die Gegenwart reagiert. Nicht verwunderlich also, dass Der Standard sie um eine Art Ratgeber für das neue Jahr gebeten hat. Der sorgte jedoch für einige Irritation: Auf hanebüchene Weise verglich Streeruwitz darin die zur Eindämmung der Pandemie beschlossenen Einschränkungen mit dem Entzug der Bürgerrechte im Nationalsozialismus. Und dieser Text ist nicht der erste, der auf diese Weise befremdet, sondern markiert allenfalls die nächste Eskalationsstufe stetig wirrer werdender Kommentare zu den politischen Folgen der Corona-Pandemie. »Ich bin in Quarantäne«, schrieb sie im November 2020 in einem ebenfalls im Standard erschienenen Essay, der neben ihrer Erfahrung mit der Corona-Politik auch den Terroranschlag in Wien in den Fokus nimmt. »Ich hatte ›einen Kontakt‹ und bin also K1. (Die Nürnberger Rassengesetze unterschieden Mischling 1 und Mischling 2. Es wäre befreiend, wenn solche Vergleiche nicht möglich wären.)« Was macht denn aber Vergleiche möglich? Der Journalist Mladen Gladić beginnt einen Kommentar zum Thema mit einer klugen Umkehr von Streeruwitz’ Annahme: »Das Eigentümlichste am Vergleichen ist, dass es Vergleichbarkeit erst schafft.«
Streeruwitz’ Essay offenbart seine logischen Mängel, ohne dass man dafür extra einen Historikerstreit beginnen müsste. Die Nürnberger Gesetze schufen die juristische Grundlage für die Ermordung von rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus. Die Quarantäneregeln für Kontaktpersonen von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, damit zu vergleichen, ist nicht einfach übertrieben – es ist auf eine ungeheuerliche Weise ahistorisch, es trivialisiert den industriellen Massenmord zur Randnotiz.
Jetzt weiterlesen? Das sind Ihre Optionen.
DIESE AUSGABE
KAUFEN
Jetzt kaufen
JETZT
ABONNIEREN
Zu den abos
Ihre Spende für kritischen Journalismus
Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.