Befreiende
Entfremdung
von Sonja Luksik
Édouard Louis beschreibt in seinem neuen Roman eindrücklich, wie er sich von seiner Klasse entfremdete. Das »Gespräch über Kunst und Politik« zwischen ihm und Filmemacher Ken Loach bleibt hingegen oberflächlich.
Als Édouard Louis ein Manuskript dessen, was später sein umjubelter Debütroman Das Ende von Eddy werden sollte, an mehrere Verlage schickt, wird ihm mitgeteilt, dass seine Geschichte unglaubwürdig sei. Die extreme Armut und Gewalt, die Louis in den Jahren der Adoleszenz in der nordfranzösischen Picardie erlebte und in seiner Niederschrift schildert, existiere heute nicht mehr. Das interpretiert der damals 19-Jährige offenbar als Aufforderung, seine Herkunftsverhältnisse umso öfter und detaillierter zu beschreiben und so zum Gegenstand öffentlicher Debatten zu machen.
In den letzten zehn Jahren hatten solch skeptische Verlegerinnen dank Louis’ Publikationen die Möglichkeit, etwas über die gewaltvollen Verhältnisse der Gegenwart zu lernen. Dabei reiht sich Édouard Louis ein in die – durch Nobelpreisträgerin Annie Ernaux geprägte – Tradition und den – durch Didier Eribons Rückkehr nach Reims ausgelösten – Trend autofiktionaler Romane aus Frankreich, die Lebenswege entlang von Armut, Scham und sozialem Aufstieg nachzeichnen. Der Vorwurf, dass es der vom Shootingstar zur Fixgröße der französischen Literaturszene avancierte Louis perfektioniert habe, ein und dasselbe Motiv, seine Biografie, in regelmäßig erscheinende Romane einzuflechten und diese damit zu vermarkten, liegt nahe.
Wer sein neuestes Werk Anleitung ein anderer zu werden (im Original Changer: Methode) liest, gewinnt jedoch noch nicht dagewesene Einblicke in die Funktion, die ebendiese Metamorphose vom geschmähten und verkannten Dorfjungen zum anerkannten Schriftsteller im komplexen und widersprüchlichen Prozess der Entfremdung einnimmt – und welch hohen Preis der Autor für seine Befreiung zahlen musste. Édouard Louis erzählt seine Geschichte als eine sich wiederholende Flucht. Vom Dorf schafft er den Sprung ins kleinstädtische Gymnasium und später an die Universität. Schnell fühlt er sich im pittoresken Amiens mit der mächtigen gotischen Kathedrale eingeengt; er bricht aus und auf nach Paris – vorerst nur an den Wochenenden. Wenn er bis zur Sperrstunde der Bar keinen Mann trifft, der ihn ins Hotelzimmer oder zu sich nach Hause mitnimmt, streift er, von Müdigkeit und Kälte gezeichnet, bis zur Abfahrt des ersten Zuges im Morgengrauen über die hellerleuchteten Plätze und durch die dunklen Gassen der Großstadt.
Auf der Flucht ist Louis auch vor sich selbst, oder zumindest vor dem durch Selbst- und Fremdwahrnehmung erschaffenen Bild von sich selbst. Über die Familie seiner Schulfreundin Elena kommt er erstmals mit bürgerlichen Verhaltensweisen in Kontakt – und beobachtet diese nicht nur akribisch, sondern imitiert sie auch. Der nordfranzösische Dialekt muss abgelegt, das Besteck richtig gehalten, der schrille Lacher gemäßigt werden. Die Nachahmung erfordert viel Konzentration, und nicht selten scheitert Louis bei den anstrengenden Versuchen, hat sich die verhasste Herkunft doch in jeder Zelle seines Körpers festgesetzt. Das Bestreben, die Erkennungsmerkmale seiner Klasse hinter sich zu lassen, gipfelt später in langwierigen Zahnbehandlungen, Haartransplantationen und einer Namensänderung. Die Möglichkeit des Ausbrechens verleiht Édouard Louis Macht, auch wenn die Begleiterscheinungen schmerzhaft anmuten: »Zu Hause war ich zu einem Fremden geworden.«
Der Drang, andere zu übertrumpfen und damit Rache zu nehmen für Beleidigungen, die er etwa aufgrund seines homosexuellen Begehrens über sich ergehen lassen musste, drückt sich in Eifer und Ehrgeiz aus. Die nächtefüllende Lektüre der Schriften von Bourdieu, Baldwin und Beauvoir entwickelt sich zu einem zwanghaften Ritual; jede Sekunde, in der Louis liest und schreibt, entfernt ihn von seiner Herkunft und bringt ihn seiner Befreiung näher.
Kunst als Konfrontation
Der Sprechakt von Unterdrückten und Deklassierten, ihr Öffentlichmachen von Leid geht seit jeher Hand in Hand mit dem Vorwurf der »Opferhaltung«. Der französische Schriftsteller identifiziert darin eine Strategie der Herrschenden, um Beherrschte »mittels Scham und Schweigen kleinzuhalten«, und stellt die Frage, wie eine Welt, in der Leidende nicht mehr über ihr Leid reden wollen, überhaupt noch verändert werden kann. Kunst habe jedenfalls die Aufgabe, die unerträgliche Realität zu zeigen; sie sollte dabei jedoch nicht stehen bleiben, sondern eine »Ästhetik der Konfrontation« entwickeln, so Édouard Louis.
Im vor kurzem auf Deutsch erschienenen Gespräch über Kunst und Politik, welches 2019 stattfand und vom Nachrichtensender Al Jazeera organisiert wurde, erkundet er solche und ähnlich gelagerte Herausforderungen zusammen mit Ken Loach. Der britische Drehbuchautor und Regisseur machte sich nicht nur mit sozialkritischen Filmen wie The Wind That Shakes the Barley, Ich, Daniel Blake und Sorry We Missed You einen Namen, er ist auch bekannt als trotzkistischer Marxist, der in der Thatcher-Ära mit Zensurversuchen konfrontiert war und in den Jahrzehnten danach nicht davor zurückschreckte, sich zu politischen Themen zu äußern. In dem mit 80 Seiten sehr mager ausgefallenen Buch, dessen französische Originalausgabe bereits 2021 erschien, fungiert Loach eher als zurückhaltender Gesprächspartner denn als glühender Theoretiker oder leidenschaftlicher Aktivist.
Louis probiert hartnäckig und leider großteils vergebens, mehr aus dem 86-jährigen Loach herauszulocken; aufschlussreich wird es schließlich dort, wo Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Künstlern auftreten und so etwas wie eine kontroverse Debatte aufflammt. Zu Beginn des Buches beschreibt Louis sein unwillkürliches Changieren zwischen Erleichterung und Freude, wenn er von Fabrikschließungen erfährt; er kenne schlicht zu viele Männer, die an den mechanischen und repetitiven Tätigkeiten zugrunde gegangen sind, und wünsche daher niemandem, an einem solchen Ort arbeiten zu müssen. Auch wenn er nicht explizit darauf Bezug nimmt, so ist davon auszugehen, dass der 30-Jährige die eindrucksvollen und zugleich beklemmenden Aufzeichnungen aus der Fabrik des vor zwei Jahren verstorbenen Joseph Ponthus, der wie Louis im postindustriellen Nordfrankreich aufwuchs, kennt.
In Gespräch über Kunst und Politik plädiert Louis dafür, das moderne Misstrauen gegenüber traditionellen Arbeitsformen (das sich heute unter anderem in der rasant wachsenden Gig-Economy niederschlage) als Linke aufzugreifen, statt für eine Rückkehr zu ebendiesen zu kämpfen. Mahnend wendet Loach ein, wie bedeutsam nicht nur Arbeit, sondern vor allem die damit verknüpfte Einbindung in ein Kollektiv für Selbstwertgefühl, den Stolz und das Finden der eigenen Stimme sind; er verweist auf die Zerschlagung des englischen Bergbaus in den 1980er-Jahren. »Wie hat wohl ein queeres Kind sein Aufwachsen in diesen Gemeinschaften von Bergleuten erlebt, von denen du sprichst?«, erwidert Louis und warnt vor einer Idealisierung; männliche Dominanz führe dazu, dass Gemeinschaften nicht allen gleichermaßen Schutz bieten.
Dies impliziert keineswegs, dass Arbeiter per se gewalttätige Barbaren sind, vielmehr lohnt sich in diesem Zusammenhang der Rückgriff auf Louis’ Analyse von »doppelter politischer Gewalt«, welche Beherrschte erfahren: »Erst, wenn sie sie erleiden, und dann, wenn sie gezwungen sind, sie zu reproduzieren.« Er weiß selbst zu gut, wie diese Gewalt Subjekte formt und wie es ist, als Getriebener seiner selbst aus dieser Form auszubrechen.

Anleitung ein anderer zu werden
Aus dem Französischen von Sonja Finck
Aufbau, 2022, 272 Seiten
EUR 24,70 (AT), EUR 24,00 (DE), CHF 34,90 (CH)
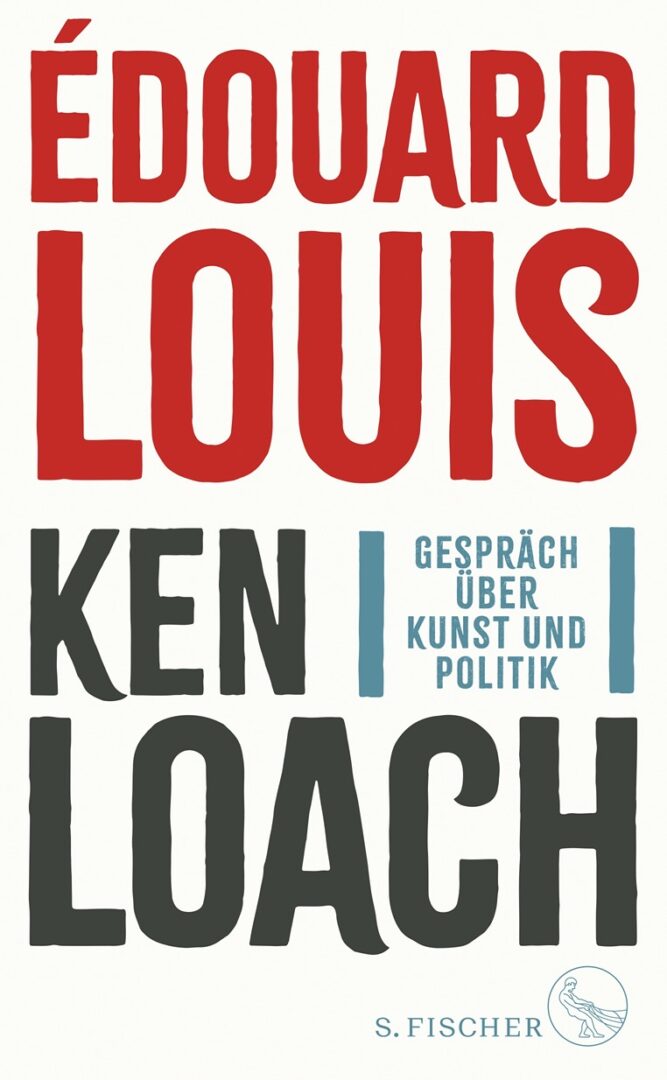
Gespräch über Kunst und Politik
Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel
S. Fischer, 2023, 80 Seiten
EUR 17,50 (AT), EUR 17,00 (DE), CHF 25,90 (CH)
Ihre Spende für kritischen Journalismus
Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.